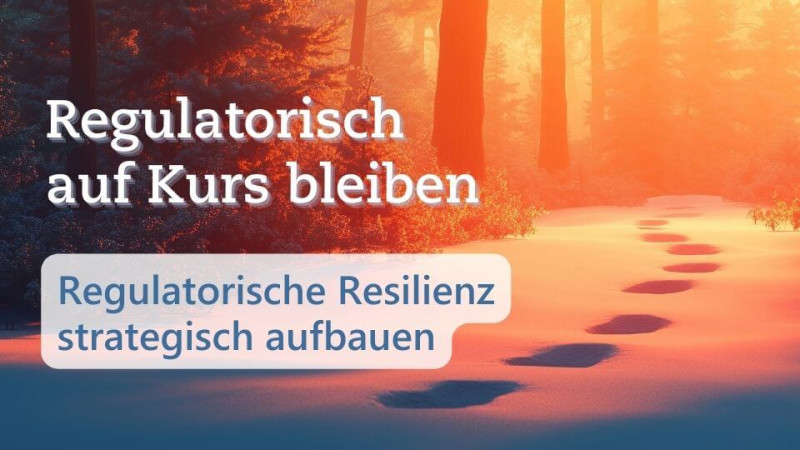Systematische Literatursuche digitalisieren: Einstieg in eine smarte Regulatory-Strategie
13.10.2025
Sie haben Fragen zum Beitrag oder möchten mehr über unsere Leistungen erfahren? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!Jetzt unverbindlich anfragen
In kaum einem anderen Bereich wird der Bedarf an Digitalisierung in Regulatory Affairs so spürbar wie bei der systematischen Literatursuche: Der Prozess ist aufwendig, manuell geprägt, wiederholt sich regelmäßig und ist dennoch entscheidend für die Klinische Bewertung, die Post-Market Surveillance und den regulatorischen Nachweis der Konformität.Medizintechnikunternehmen setzen daher vermehrt auf digitale Lösungen, um Abläufe effizienter zu gestalten, Fehlerquellen zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Doch die Auswahl der richtigen Software erfordert mehr als ein gutes Bauchgefühl: Sie ist eine strategische Entscheidung mit weitreichenden Auswirkungen. Und damit Chefsache.
Wichtig ist zudem, dass der gesamte Prozess von der Selektion bis zur Extraktion relevanter Informationen strukturiert abgebildet werden kann inklusive revisionssicherer Dokumentation, die regulatorischen Anforderungen standhält.Der Funktionsumfang allein ist allerdings kein Garant für Qualität. Ebenso wichtig ist, wie gut sich die Software in bestehende Prozesse einfügt. Lösungen, die umfangreiche Schulungen oder eine vollständige Prozessumstellung erfordern, können selbst mit beeindruckenden Funktionen im Alltag scheitern. Auch die Qualität des Supports, die Validierung der Software und die Möglichkeit zur Weiterentwicklung sollten Teil der Entscheidung sein.Kurzum: Die beste Software ist die, die zu den Prozessen, Zielen und Ressourcen des Unternehmens passt, und nicht zwangsläufig die, die am meisten verspricht.
In manchen Tools lassen sich Publikationen sogar über ein Chat-Fenster befragen: Ein KI-Assistent schlägt Antwortformulierungen oder Appraisal-Beurteilungen vor.So vielversprechend diese Funktionen klingen, bergen sie auch Risiken. Noch ist nicht klar, inwieweit KI-gestützte Arbeitsschritte, etwa automatisierte Selektionen, regulatorisch zulässig sind. Benannte Stellen reagieren hier zurückhaltend, insbesondere wenn der Mensch nicht mehr eindeutig nachvollziehen oder eingreifen kann.Zudem stellt sich die Frage, ob die KI wirklich Zeit spart oder durch Überprüfung und Nachbesserung sogar mehr Aufwand verursacht. Eine KI ist immer nur so gut wie die Daten, auf denen sie trainiert wurde – und nur so transparent, wie ihr Verhalten nachvollziehbar ist.Unserer Erfahrung nach lohnt sich der Einsatz von KI, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind: Die Funktionen müssen erklärbar und abschaltbar sein, ihre Ergebnisse validierbar, und der Anwender muss jederzeit die Kontrolle behalten. Nur unter diesen Bedingungen kann KI eine echte Unterstützung bieten, und zwar nicht nur in der Theorie, sondern auch im regulatorischen Alltag.
 Sabine Schumann-Hahn
Sabine Schumann-Hahn
Warum die Literatursuche ein idealer Einstieg in die Digitalisierung ist
Die systematische Literatursuche eignet sich hervorragend als Ausgangspunkt für eine digitale Transformation im Regulatory-Bereich. Denn sie ist einerseits ein klar strukturierter Prozess, andererseits stark standardisiert und zugleich aufwendig in der Umsetzung.Obwohl die Abläufe der systematischen Literatursuche klar definiert sind (z. B. nach PICO, MEDDEV 2.7/1 Rev. 4), ist die tatsächliche Durchführung sehr zeit- und ressourcenintensiv, weil sie:- viele manuelle Teilschritte umfasst (z. B. Datenbankrecherche, Selektion, Appraisal, Dokumentation der Ergebnisse),
- hohe Sorgfalt verlangt,
- sich regelmäßig wiederholt (z. B. im Rahmen von PMS, PMCF, Re-Zertifizierungen, Darstellung des Stands der Technik),
- und oft mehrere Personen über verschiedene Abteilungen hinweg einbindet (Regulatory, Clinical, QM etc.).
Was eine gute Software können muss – und was nicht
Eine leistungsfähige Lösung zur systematischen Literatursuche sollte Anwender dabei unterstützen, Suchstrategien nach etablierten Ansätzen wie dem PICO-Modell zu definieren. Sie sollte über eine stabile Anbindung an relevante wissenschaftliche Datenbanken verfügen; idealerweise nicht nur an PubMed, sondern auch an Plattformen wie zum Beispiel clinicaltrials.gov, Cochrane Database of Systematic Reviews, EBSCO oder Embase.Wichtig ist zudem, dass der gesamte Prozess von der Selektion bis zur Extraktion relevanter Informationen strukturiert abgebildet werden kann inklusive revisionssicherer Dokumentation, die regulatorischen Anforderungen standhält.Der Funktionsumfang allein ist allerdings kein Garant für Qualität. Ebenso wichtig ist, wie gut sich die Software in bestehende Prozesse einfügt. Lösungen, die umfangreiche Schulungen oder eine vollständige Prozessumstellung erfordern, können selbst mit beeindruckenden Funktionen im Alltag scheitern. Auch die Qualität des Supports, die Validierung der Software und die Möglichkeit zur Weiterentwicklung sollten Teil der Entscheidung sein.Kurzum: Die beste Software ist die, die zu den Prozessen, Zielen und Ressourcen des Unternehmens passt, und nicht zwangsläufig die, die am meisten verspricht.
KI-Funktionen: sinnvoll oder Spielerei?
Viele Anbieter werben mit KI-basierten Funktionen. In der Praxis bedeutet das z. B., dass ein System Vorschläge zur In- oder Exklusion von Publikationen auf Basis bereits getroffener Entscheidungen macht, automatisch Zusammenfassungen generiert, quantitative Daten extrahiert oder besonders relevante Textstellen im Volltext hervorhebt.In manchen Tools lassen sich Publikationen sogar über ein Chat-Fenster befragen: Ein KI-Assistent schlägt Antwortformulierungen oder Appraisal-Beurteilungen vor.So vielversprechend diese Funktionen klingen, bergen sie auch Risiken. Noch ist nicht klar, inwieweit KI-gestützte Arbeitsschritte, etwa automatisierte Selektionen, regulatorisch zulässig sind. Benannte Stellen reagieren hier zurückhaltend, insbesondere wenn der Mensch nicht mehr eindeutig nachvollziehen oder eingreifen kann.Zudem stellt sich die Frage, ob die KI wirklich Zeit spart oder durch Überprüfung und Nachbesserung sogar mehr Aufwand verursacht. Eine KI ist immer nur so gut wie die Daten, auf denen sie trainiert wurde – und nur so transparent, wie ihr Verhalten nachvollziehbar ist.Unserer Erfahrung nach lohnt sich der Einsatz von KI, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind: Die Funktionen müssen erklärbar und abschaltbar sein, ihre Ergebnisse validierbar, und der Anwender muss jederzeit die Kontrolle behalten. Nur unter diesen Bedingungen kann KI eine echte Unterstützung bieten, und zwar nicht nur in der Theorie, sondern auch im regulatorischen Alltag.
Softwareauswahl mit Weitblick und mit System
Die Entscheidung für eine Softwarelösung zur systematischen Literatursuche ist mehr als ein Technologiethema: Sie betrifft die tägliche Arbeit im Regulatory- und Clinical-Team, die Qualität der Technischen Dokumentation und letztlich den Marktzugang.Ein strukturierter Auswahlprozess ist deshalb entscheidend: Die richtige Lösung entlastet nicht nur einzelne Mitarbeitende, sondern kann langfristig zum Fundament für die Digitalisierung weiterer Prozesse werden, etwa im Rahmen eines RIMS (Regulatory Information Management Systems), in der Automatisierung von PMS-Abläufen oder der teamübergreifenden Koordination regulatorischer Anforderungen.Checkliste: Darauf sollten Entscheider bei der Softwareauswahl achten
- Haben Sie klare Anforderungen definiert: fachlich, technisch, organisatorisch?
- Haben Sie Ansprechpartner? Ist der Anbieter offen für Feedback und Weiterentwicklung?
- Gibt es eine nachvollziehbare Validierungsstrategie?
- Können alle betroffenen Rollen und Abteilungen mit dem Tool arbeiten?
- Welche Datenbanken sind angebunden, und wie stabil ist diese Anbindung?
- Wie skalierbar ist das Tool im Hinblick auf andere Prozesse (z. B. RIMS)?
- Welche KI-Funktionen sind enthalten? Und wie werden sie erklärt, dokumentiert und abgesichert?
So stellen Sie sich intern optimal auf
Bevor die Softwareauswahl überhaupt beginnen kann, sollte intern Klarheit herrschen: Wer treibt das Projekt an? Wer entscheidet? Und wer wird später mit der Lösung arbeiten? Für ein erfolgreiches Digitalisierungsprojekt ist es entscheidend, ein interdisziplinäres Kernteam aufzustellen, das sowohl Fachanforderungen als auch Prozesssicht und regulatorische Perspektive einbringt.Neben Clinical und Regulatory sollten auch IT, Qualitätsmanagement und, sofern vorhanden, Digitalisierungs- oder Innovationsverantwortliche frühzeitig eingebunden werden. Eine klare Rollenverteilung im Projekt, definierte Kommunikationswege und abgestimmte Ziele sorgen dafür, dass Entscheidungen fundiert und praxisnah getroffen werden und nicht am Ende an Akzeptanz oder Umsetzung scheitern.Unser Tipp: Legen Sie zu Projektbeginn fest, wer Anforderungen sammelt, wer mit Anbietern spricht, wer bewertet. Und wer später die Verantwortung für Nutzung und Pflege übernimmt.Unsere Haltung bei Metecon: Digitalisierung als strategischer Hebel
Wir begleiten Medizintechnikunternehmen seit Jahren bei der Auswahl und Implementierung von Softwarelösungen, mit einem klaren Fokus auf regulatorische Machbarkeit, Prozesssicherheit und strategischen Mehrwert.Die Stärken der Anbieter sind unterschiedlich verteilt: Während große Unternehmen meist mit Stabilität und Ressourcen punkten, sind kleinere Anbieter eventuell innovationsfreudiger und offener für neue Impulse.Als Regulatory-Partner mit breiter Anwendungserfahrung verfügen wir über die besondere Möglichkeit, direkt mit Softwareentwicklern in den Dialog zu treten; ein Zugang, den klassische Nutzer in dieser Tiefe oft nicht haben. Dieser Austausch auf Augenhöhe ermöglicht es uns, Rückmeldungen aus der Praxis gezielt einzubringen und aktiv zur Weiterentwicklung von Funktionen der Software und regulatorischer Dokumentation beizutragen.Für unsere Kunden bedeutet das: Sie profitieren nicht nur von unserer Marktübersicht, sondern auch von unserem direkten Draht zu den Anbietern und von Lösungen, die sich nachweislich an den Bedürfnissen regulatorischer Anwender orientieren.Wir wissen, dass die Einführung einer Softwarelösung kein Selbstzweck ist. Sie muss sich in die bestehende Systemlandschaft einfügen, zu den Rollen und Verantwortlichkeiten im Unternehmen passen und regulatorisch valide aufgestellt sein. Und: Sie muss akzeptiert und verstanden werden.Deshalb unterstützen wir nicht nur bei der Toolauswahl, sondern helfen, die internen Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einsatz zu schaffen: von der Prozessanalyse über die Anbieterkommunikation bis zur Validierungsstrategie und Mitarbeiterschulung.Fazit: Jetzt den Grundstein für eine digitale Regulatory-Strategie legen
Die Digitalisierung der systematischen Literatursuche ist weit mehr als ein Effizienzprojekt. Sie ist ein praxisnaher, skalierbarer Einstieg in eine umfassendere digitale Transformation und bietet die Chance, Prozesse nachhaltiger, nachvollziehbarer und resilienter aufzustellen.Wer hier strategisch vorgeht, schafft nicht nur Entlastung im Alltag, sondern legt die Basis für echte Regulatory Intelligence mit Potenzial für KI, RIMS und automatisiertes Compliance-Management.Ihr nächster Schritt: Mit Metecon die passende Lösung finden
Sie stehen am Anfang Ihrer Digitalstrategie oder möchten Ihre bestehenden Tools kritisch bewerten? Wir unterstützen Sie von der Anforderungsanalyse über die Bewertung möglicher Anbieter bis zur erfolgreichen Integration – regulatorisch fundiert, praxiserprobt und mit Blick aufs große Ganze.Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Literatursuche digital transformieren – und darüber hinaus denken. Kontaktieren Sie uns für ein erstes unverbindliches Kennenlernen.
Unsere Blogbeiträge werden mit höchster Sorgfalt recherchiert und erstellt, sind jedoch lediglich Momentaufnahmen in der Regulatorik, und diese ist in stetem Wandel. Wir gewährleisten nicht, dass ältere Inhalte noch aktuell und aussagekräftig sind. Wenn Sie nicht sicher sind, ob der Beitrag, den Sie auf dieser Seite gelesen haben, noch dem aktuellen Stand der Regulierung entspricht, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf: Wir ordnen Ihr Thema schnell in den aktuellen Kontext ein.

Team Lead Post-Market Surveillance